Dezember 2025
Cannabis wieder verbieten!
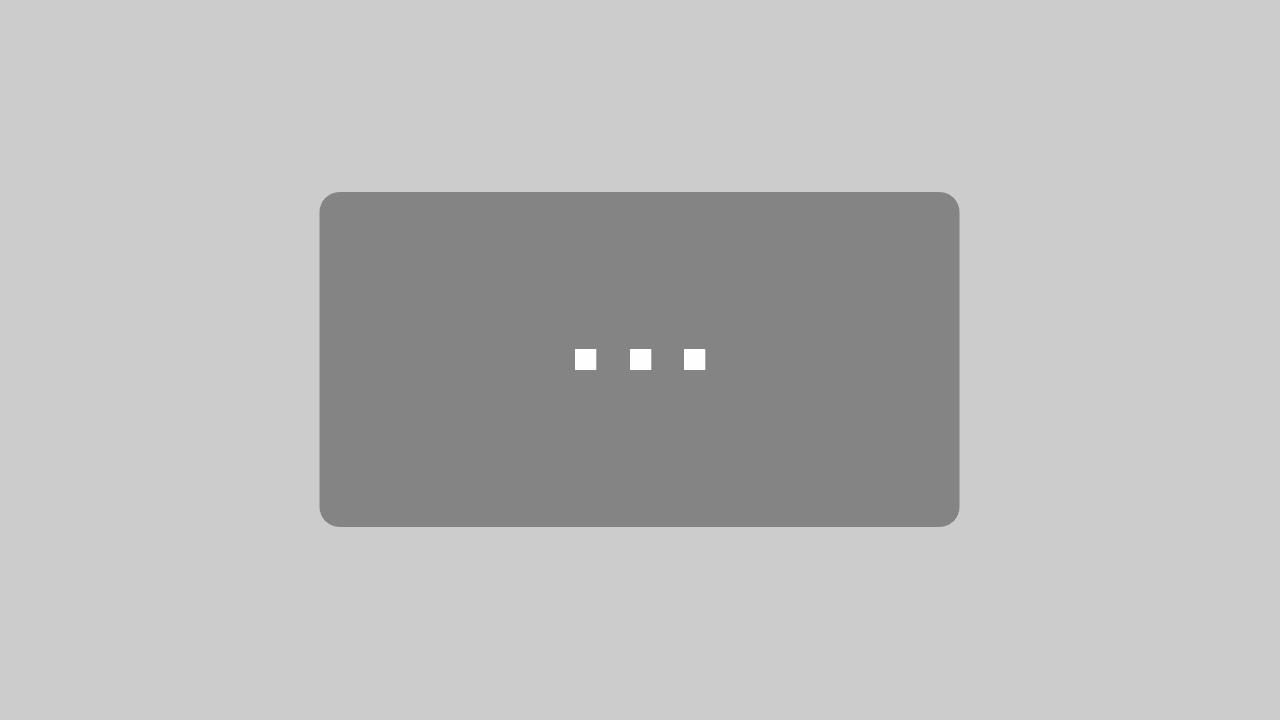
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Hier ist künstliche Intelligenz eine echte Dummheit!
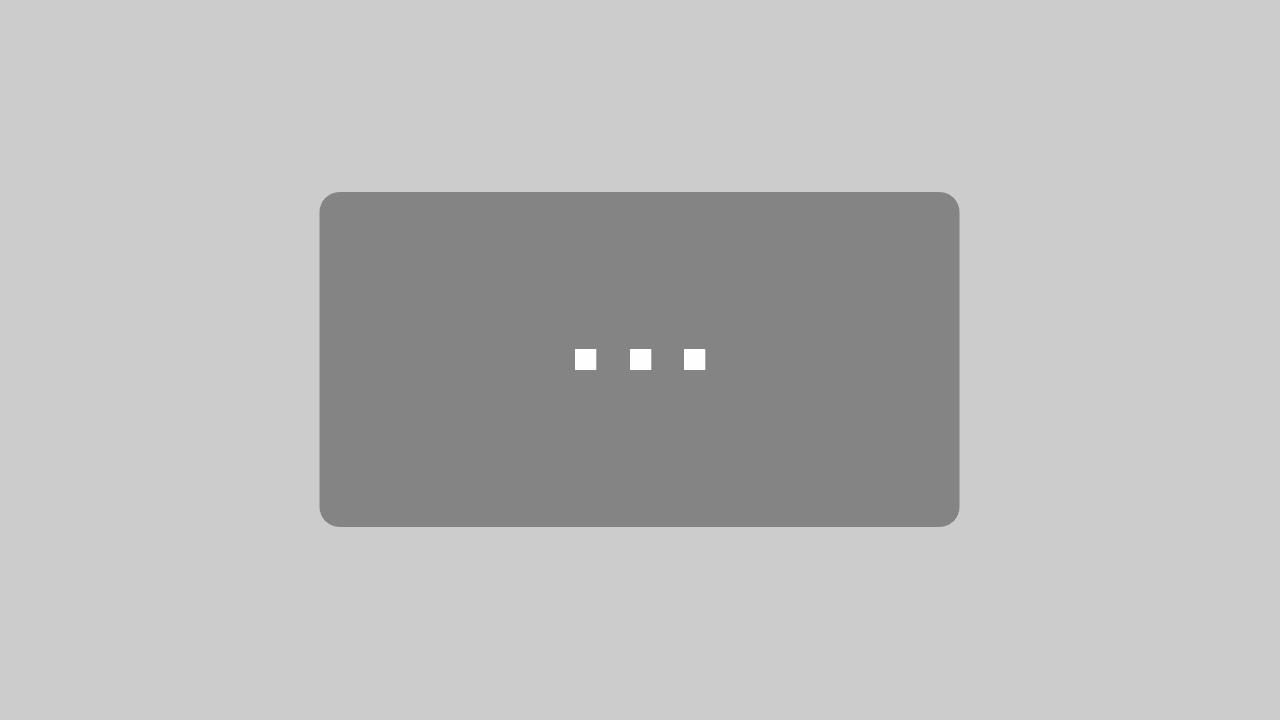
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Grüne kreischen, als ihr Diversity-Schwindel auffliegt!
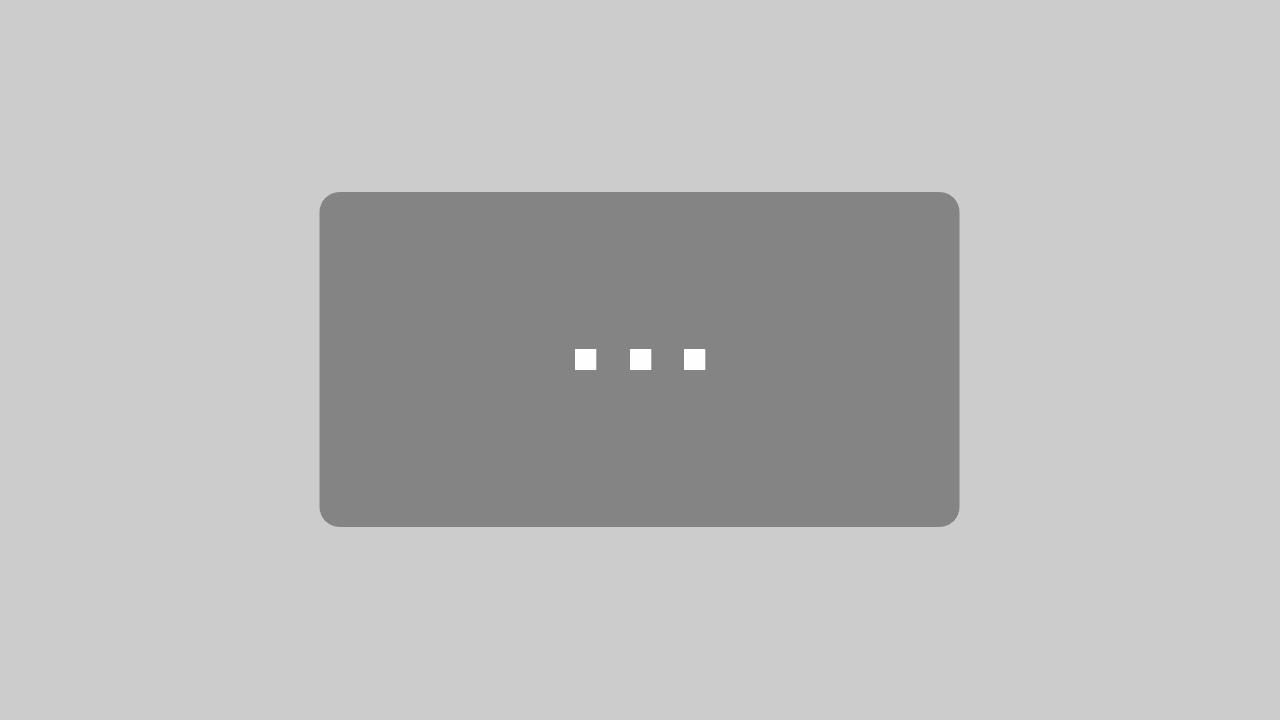
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
November 2025
Justizvollzugsanstalten in NRW – Entwicklung des Anteils ausländischer Strafgefangener und der Anzahl von Übergriffen gegenüber Justizvollzugsbeamten – Nachfrage
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 6598 (Drucksache 18/16093).
Mit Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/15661) auf unsere Kleine Anfrage 6429 (Drucksache 18/15724) wurde Frage 3
Welche Informationen liegen der Landesregierung zu den Staatsangehörigkeiten der Gefangenen vor? (Bitte die Herkunftsländer und die Anzahl der nichtdeutschen Gefangenen für jede Justizvollzugsanstalt von 2021 bis 2025 aufschlüsseln, zusätzlich bitte bei den deutschen Gefangenen differenziert nach Vornamen und Anzahl aufschlüsseln)
wie folgt beantwortet
Im Justizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Staatsangehörigkeiten der Gefangenen sowie der in der Sicherungsverwahrung untergebrachten Personen erfasst. Die nachfolgende Übersicht stellt die Anzahl dieser Personen sowie deren Staatsangehörigkeitsstatus zu den erbetenen Stichtagen dar.
31.07.2021 31.07.2022 31.07.2023 31.07.2024 31.07.2025 Anzahl der deutschen Gefangenen und Untergebrachten ohne eine weitere Staatsangehörigkeit 8049 7824 7969 7518 7284 Anzahl der deutschen Gefangenen und Untergebrachten mit einer weiteren Staatsangehörigkeit 609 696 827 861 885 Anzahl der Gefangenen und Untergebrachten ohne deutsche Staatsangehörigkeit 4952 5046 5435 5657 5805 Anzahl der Gefangenen und Untergebrachten mit unbekannter Staatsangehörigkeit 45 57 61 51 56 Anzahl der Gefangenen und Untergebrachten ohne Staatsangehörigkeit 26 29 38 39 40
Wir fragten daher die Landesregierung:
- Wie lauten jeweils die Vornamen der 7.284 (Tabellenspalte 31.07.2025) deutschen Gefangenen bzw. Untergebrachten ohne eine weitere Staatsangehörigkeit?
- Wie lauten jeweils die Vornamen der 885 (Tabellenspalte 31.07.2025) deutschen Gefangenen bzw. Untergebrachten mit einer weiteren Staatsangehörigkeit?
Die Antwort der Landesregierung ist exemplarisch für die Auskunftsunfreudigkeit der Landesregierung: Obwohl wir die jeweiligen Vornamen sämtlicher 7.284 beziehungsweise 885 Gefangenen beziehungsweise Untergebrachten erfragten, erhielten wir lediglich Aufstellungen von 1.428 beziehungsweise 589 unterschiedlichen Vornamen ohne Häufigkeitsangaben. Die Landesregierung vermeidet durch diese Darstellungsform eine belastbare statistische Einordnung.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/16612).
Bedroht und verprügelt: Beamte sind in Buntland nicht mehr sicher!
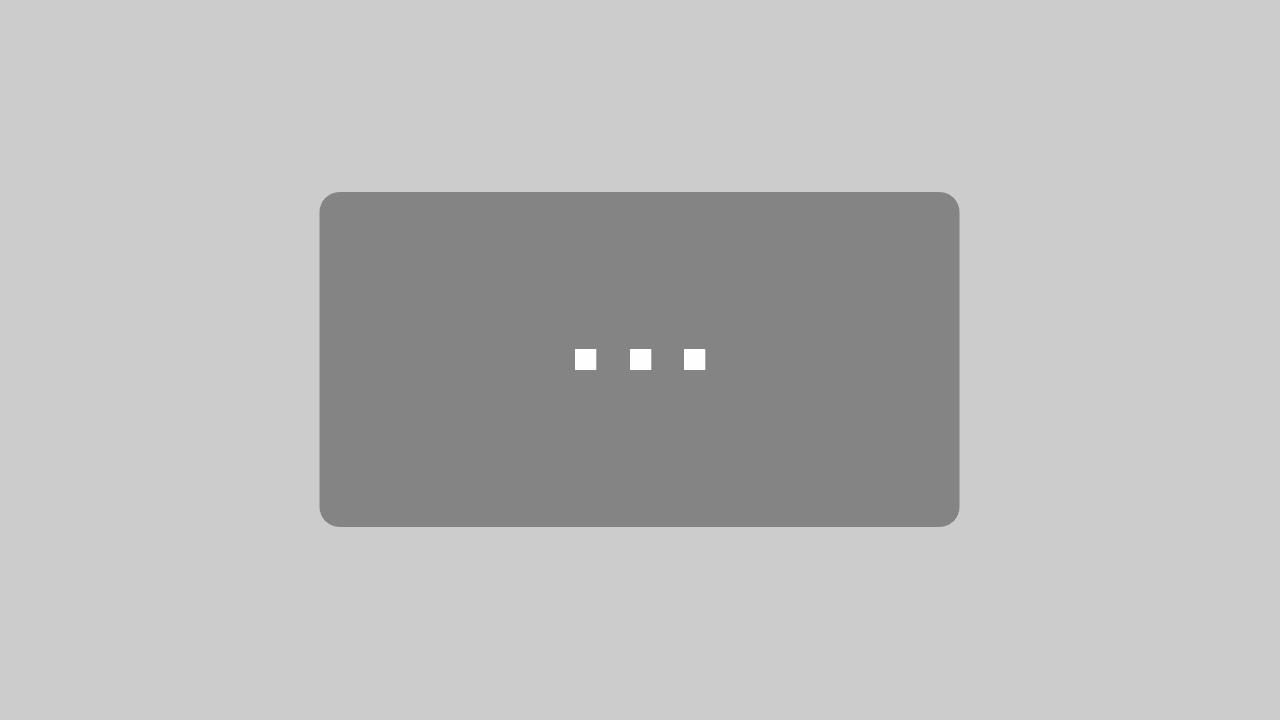
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Strack-Zimmermann-Truppe nur noch peinlich und armselig!
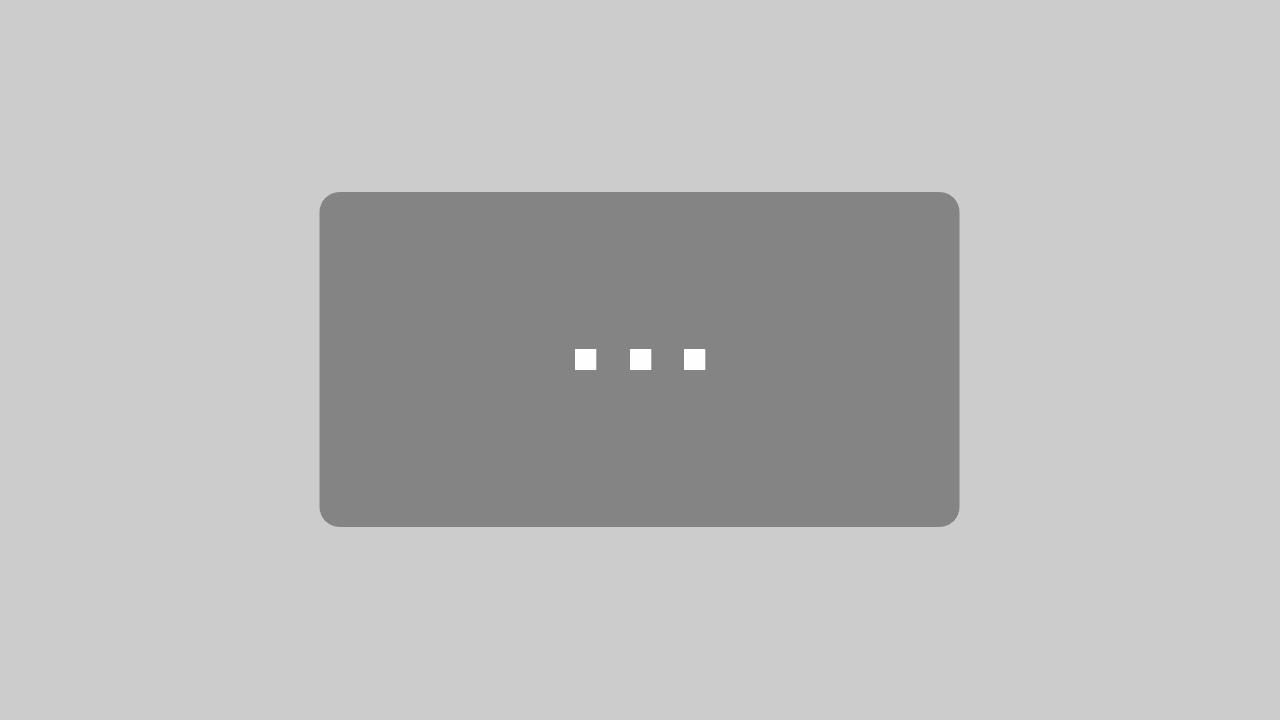
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
4 Gründe, warum der Verfassungsschutz weg muss!
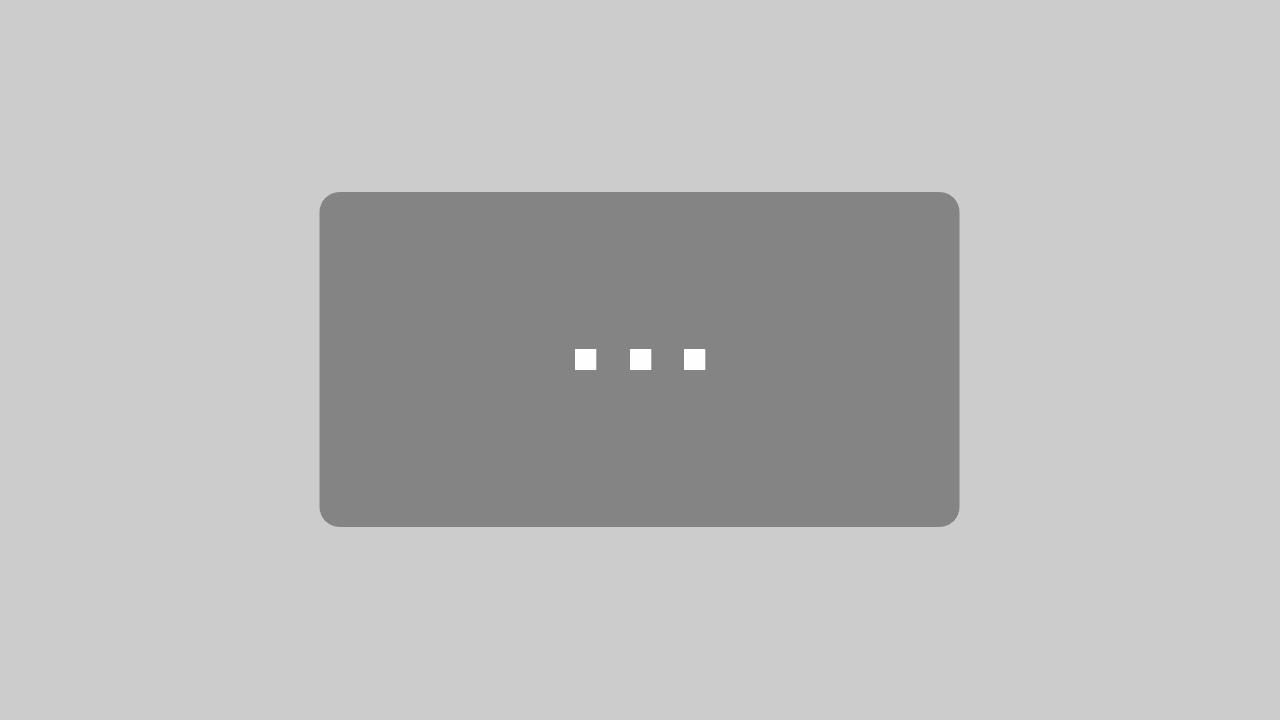
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
AfD beweist wahres Ziel der Hausdurchsuchung!
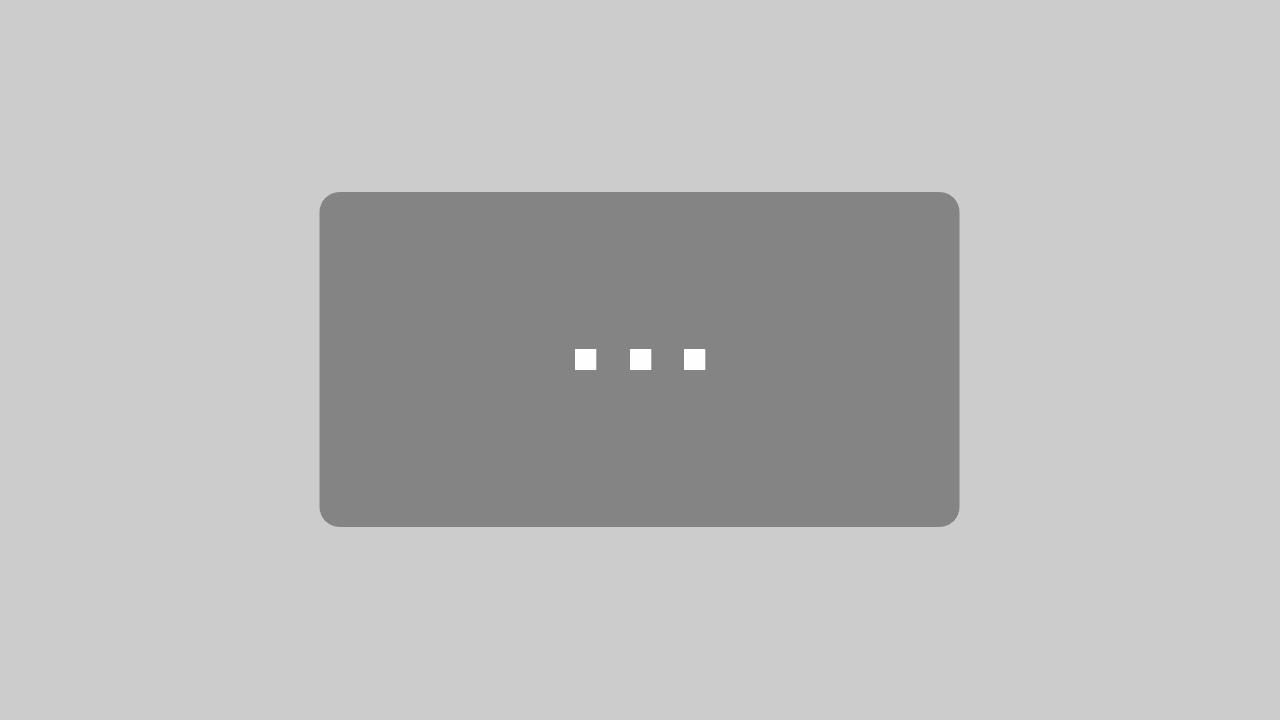
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zu unserer Großen Anfrage 32 „Hausdurchsuchungen bei Beleidigungsdelikten in Nordrhein-Westfalen: Umfang, Verhältnismäßigkeit und Vergleich mit anderen Straftaten“ (Drucksache 18/12374) und der Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14588).
