Juni 2025
Förderung durch Umwelt-, Heimat- und Europa-Schecks in den Kreisen Nordrhein-Westfalens im Jahr 2024
Die Landesregierung hat in den letzten Jahren mehrere umfangreiche Programme zur Förderung „zivilgesellschaftlicher Beteiligung“ auf den Weg gebracht. 2018 wurde mit dem Heimat-Scheck begonnen, 2023 folgte der Europa-Scheck und dieses Jahr der Umweltscheck. Damit werden eine Vielzahl an Projekten, Veranstaltungen und Organisationen im gesamten Land finanziell unterstützt.
Die Landesregierung verkauft diese ‚Schecks‘ stets als Erfolg und erweitert die finanziellen Mittel ebenso wie immer neue Themengebiete.
Auf die Frage, welchen genauen Zweck die Förderungen erreichen sollen oder wie sie den bisherigen Erfolg bemisst, blieb die Landesregierung bisher eine klare Antwort schuldig.
Wir fragten daher die Landesregierung:
- Welche Projekte oder ähnliches wurden 2024 im Kreis Paderborn durch ein solches Programm gefördert? (Bitte einzeln und nach Förderprogramm aufschlüsseln sowie die Fördersumme angeben.)
- Welche Anträge wurden 2024 abgelehnt? (Bitte einzeln und nach Förderprogramm aufschlüsseln sowie die Fördersumme angeben.)
- Wie kontrolliert die Landesregierung die Verwendung der Mittel?
- Wie bemisst die Landesregierung den Erfolg der geförderten Projekte? (Bitte einzeln aufschlüsseln.)
Bezüglich der ersten beiden Fragen verweist die Landesregierung auf diverse eigentliche Veröffentlichungen, wobei sich jedoch zeigt, dass bezüglich abgelehnter Anträge wenig Transparenz herrscht beziehungsweise bezüglich der Umweltchecks wegen eines „Programmfehlers“ keine Auskunft gegeben werden kann.
Auf die Frage, wie die Landesregierung die Verwendung der Mittel kontrolliert, antwortet sie knapp: „Die Prüfung der Verwendung der Mittel nebst Erfolgskontrolle erfolgt gemäß den Regeln der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung.“
Zur vierten Frage führt die Landesregierung zum Beispiel aus, dass Umwelt-, Heimat- und Europa-Schecks „bedeutende Instrumente zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements“ seien und dass Europa-Schecks dazu beitrügen, „dass Bürgerinnen und Bürger sich für die europäischen Werte in Nordrhein-Westfalen einsetzen und den europäischen Gedanken in der Zivilgesellschaft stärken.“ Dabei bleibt die Landesregierung bleibt den Nachweis schuldig, wie die Fördermittel konkret zum behaupteten Erfolg beitragen.
Kleine Anfragen:
- Bielefeld: Kleine Anfrage 5484 (Drucksache/13599), Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14151)
- Kreis Gütersloh: Kleine Anfrage 5504 (Drucksache/13619), Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14171)
- Kreis Herford: Kleine Anfrage 5505 (Drucksache/13620), Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14172)
- Kreis Höxter: Kleine Anfrage 5506 (Drucksache/13621), Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14173)
- Kreis Lippe: Kleine Anfrage 5509 (Drucksache/13624), Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14176)
- Kreis Minden-Lübbecke: Kleine Anfrage 5511 (Drucksache/13626), Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14150)
- Kreis Paderborn: Kleine Anfrage 5513 (Drucksache/13628), Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/14179)
Mai 2025
Umdeutung der rechtlich unbestimmten, beliebig definierbaren Begriffe „Hass“ und „Hetze“ für politische Zwecke
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 5403 (Drucksache 18/13461).
Immer öfter agieren auch Mitglieder der Landesregierung in der politischen Debatte mit den Begriffen „Hass“ und „Hetze“. Anders als klar definierte Straftatbestände, wie z. B. üble Nachrede oder Verleumdung, sind diese aber nicht eindeutig definiert. „Hass“ ist zunächst einmal ein Gefühl, wie am anderen Ende der Skala „Liebe“. Eine Strafbarkeit von Gefühlen gibt es nicht.
Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff der „Hetze“. Was als „Hetze“ definiert wird, ist subjektiv und liegt zunächst einmal im Auge des Betrachters. Ist damit ein Straftatbestand, wie z. B. Volksverhetzung gemeint, dann gibt es hierzu eine Definition im Strafgesetzbuch. Ist damit aber kein Straftatbestand gemeint, sondern z. B. lediglich Kritik (auch wenn diese überspitzt oder polemisch ist) an Regierungshandeln oder politischen Mitbewerbern innerhalb und außerhalb der Regierung, dann ist dies für den Adressaten ggf. ärgerlich, aber selbstverständlich legal und Teil des politischen Diskurses in einem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat.
Vor diesem Hintergrund ist es von Interesse, was Vertreter der Landesregierung im Detail meinen, wenn sie mit den Begriffen „Hass“ und „Hetze“ agieren. Wer damit völlig zu Recht lediglich strafbare Handlungen beklagen möchte, sollte diese besser auch konkret benennen, um nicht dem Verdacht zu unterliegen andere, nicht strafbare und verfassungskonforme Positionen und Aussagen mit den Begriffen „Hass“ und „Hetze“ quasi kriminalisieren zu wollen, was im Extremfall einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gleichkäme.
Wir fragten daher die Landesregierung:
- Wie definiert die Landesregierung die rechtlich unbestimmten Begriffe „Hass“ und „Hetze“ genau? (Bitte jeweils im Detail ausführen)
- Welche strafbaren Handlungen subsumiert die Landesregierung unter den Begriffen „Hass“ und „Hetze“ im Detail? (Bitte die zugehörigen Paragrafen im StGB listen)
- Welche nicht strafbaren Handlungen subsumiert die Landesregierung unter den Begriffen „Hass“ und „Hetze“ im Detail? (Bitte im Detail listen und konkrete Beispiele benennen)
- Sollte die Landesregierung auch nicht-strafbare Handlungen unter den Begriffen „Hass“ und „Hetze“ subsumieren: Warum und insbesondere auf Basis welcher Rechtsgrundlage werden von Seiten der Landesregierung nicht strafbare Handlungen kriminalisiert? (Bitte auch Angaben zur Verfassungskonformität eines derartigen Vorgehens tätigen)
- Inwiefern ist ein derartiges Vorgehen nach Ansicht der Landesregierung mit der im Grundgesetz verankerten Meinungsfreiheit, der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Meinungsfreiheit als Abwehrrecht des Bürgers gegenüber dem Staat, mit europäischem Recht, wie z. B. der Europäischen Menschenrechtskonvention, bzw. mit der UN-Menschenrechtskonvention (Art. 19) kompatibel? (Bitte im Detail ausführen)
Statt eine konkrete Antwort zu geben, verweist die Landesregierung in ihrer Antwort auf Frage 1 auf Fragen in unserer Großen Anfrage 23 (Drucksache 18/9680) und im Weiteren auf die Antwort auf Frage 1. Aber schon in ihrer Nichtantwort gibt die Landesregierung zu, dass es „keine klare, allgemein akzeptierte Definition“ gebe und die Begriffe keine juristisch definierten Begriffe seien.
Dass die Landesregierung sich weiter weigert, eine Abgrenzung zwischen legalen Meinungsäußerungen strafbaren Handlungen vorzunehmen und sogar Meldestellen eingerichtet hat, welche explizit auch legale Meinungsäußerungen dokumentieren sollen, lässt den Schluss zu, dass die Landesregierung den Aufbau von Chilling Effects, das heißt eine Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Selbstzensur, mindestens in Kauf nimmt.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/13982).
Juni 2022
Eins, zwei oder drei? Die zweite Auffrischungsimpfung in der Kritik
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 6565 (Drucksache 17/17096).
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus Covid-19 für Menschen ab 70 Jahren, für Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen ab 5 Jahren mit Immunschwächen und Beschäftigten in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Die Effektivität der vierten Dosis wird hingegen mittlerweile kritisch betrachtet. So legen Studien aus Israel nahe, dass die zweite Auffrischungsimpfung bzgl. der Omikron-Variante nur geringe Schutzwirkungen aufweise.
Wir fragten daher die Landesregierung:
- Wie viele Personen in Nordrhein-Westfalen haben eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten? (Bitte aufschlüsseln nach Alter, Art des Vakzins und Zeitraum der Verabreichung der Vakzine)
- Bei wie vielen dieser mit einer zweiten Auffrischungsimpfung versehenen Personen kam es zu einer nachträglichen Infektion mit einer Variante des SARS-CoV-19-Virus? (Bitte aufschlüsseln nach Alter, Art des Vakzins und Zeitraum der Verabreichung der Vakzine)
- Wie hoch schätzt die Landesregierung den Schutz durch eine zweite Auffrischungsimpfung ein, insbesondere hinsichtlich der Omikron-Variante?
In ihrer Antwort offenbart die Landesregierung abermals, dass es ihr in den mehr als zwei Jahren seit dem ersten Covid-19-Fall in Deutschland nicht möglich war, eine funktionierende Datenerfassung aufzubauen. So gibt sie in ihrer Antwort auf die zweite Frage zu, dass „die vorliegenden und folgend aufgeführten Daten […] keinen validen Rückschluss auf das tatsächliche Infektionsgeschehen in dieser Personengruppe“ erlaubten. Auch scheint es, dass der Vergleich verschiedener Kennziffern erschwert werden soll, da zum Teil ausschließlich absolute Werte angeben werden und zum Teil ausschließlich relative Werte.
In Anbetracht der jetzt schon gestarteten Diskussion über die Maßnahmen für den kommenden Winter sind diese Daten aber elementar; besonders, da die gewisse Akteure eine weitere Impfkampagne und mehr zweite Auffrischungsimpfungen fordern.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 17/17132).
Mai 2022
PUA stellt fest: Weißer Mann mit schwarzem Mann verwechselt
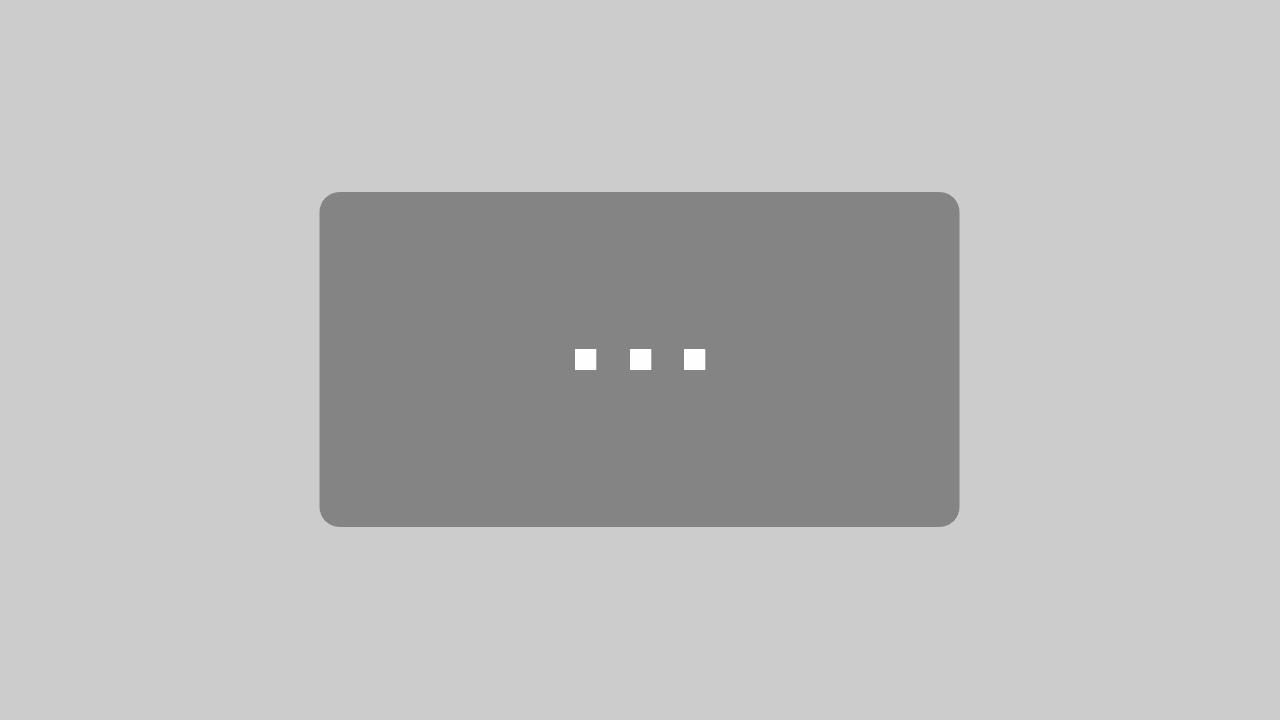
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
April 2022
Ihr laues Gesetz ist purer Wahlkampfpopulismus
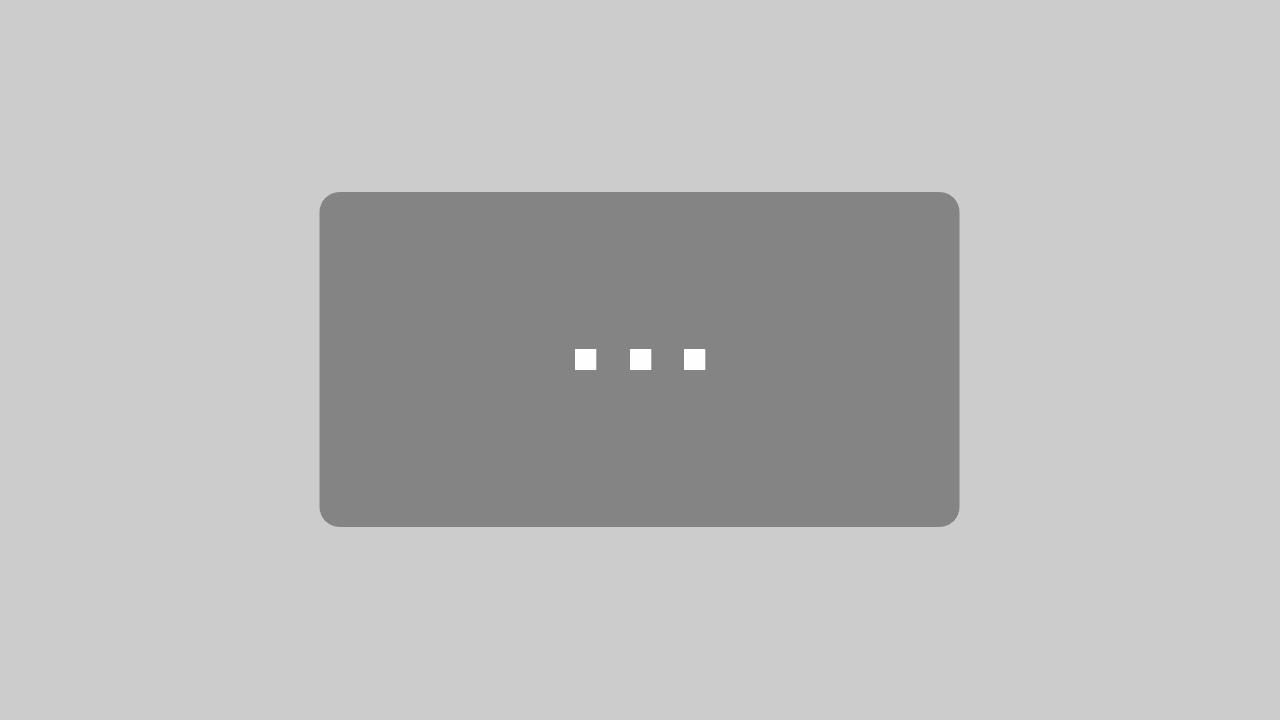
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Der Letzte macht das Licht aus – Energieversorgungssicherheit in Nordrhein-Westfalen
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 6475 (Drucksache 17/16748).
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz schätzt die Gefahr eines flächendeckenden totalen Stromausfalls in Europa als wahrscheinlichste Katastrophe ein. Grund hierfür sind die Energiewende und das Abschalten der Atomkraftwerke in Deutschland.
Im Jahre 2021 kam es zweimal fast zu einem flächendeckenden Stromausfall. Die durch einen flächendeckenden Blackout entstehenden Schäden werden dabei vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz höher eingestuft als die Schäden einer neuerlichen Pandemie oder von Regenfluten, wie sie im Sommer letztens Jahres zu Überflutungen geführt haben. Schon wenige Tage – das Bundesamt nimmt hierbei konkret einen Zeitraum von drei Tagen an – ohne Strom würden katastrophale Ausmaße annehmen, da unter anderem die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen und Notstromaggregate nicht mehr mit Diesel versorgt werden könnten. Die flächendeckende Versorgung mit Lebensmitteln, lebensnotwendigen Gütern und entsprechenden Dienstleistungen könnte nicht mehr vollumfänglich sichergestellt werden.
Wir fragten daher die Landesregierung:
- Wie oft kam es innerhalb der letzten fünf Jahre im nordrhein-westfälischen Stromnetz zu Schwankungen, welche die Gefahr eines flächendeckenden Blackouts innehatten? (Bitte aufschlüsseln nach Jahr, Kreis bzw. Gemeinde, getroffenen Gegenmaßnahmen)
- Sind strafrechtlich relevante Sachverhalte aus den letzten fünf Jahren bekannt, welche die energieproduzierende bzw. energieversorgende Infrastruktur beeinträchtigen sollten, bspw. durch Sabotage oder Cyberattacken? (Bitte auflisten nach Jahr, Art der Manipulation, Deliktart, Art der Beendigung der Ermittlungen bzw. des Strafprozesses)
- Welche Notfallpläne und Gegenmaßnahmen hat die Landesregierung für den Fall eines flächendeckenden Stromausfalls ausgearbeitet?
- Sind zur Verhinderung von flächendeckenden Stromausfällen Maßnahmen geplant, Infrastrukturen bzw. kritische Infrastrukturen, Landkreise oder einzelne Gemeinden, große energieverbrauchende bzw. energieerzeugende Anlagen vom Stromnetz vorübergehend zu kappen, sollte es zu starken Schwankungen innerhalb des Stromnetzes kommen?
- Welche Anlagen, Landkreise, Gemeinden, Infrastrukturen bzw. kritischen Infrastrukturen sollen dann zu welchen Zeitpunkten abgeschaltet werden (Bitte erläutern, welche Priorität ist für eine derartige Abschaltung vorgesehen ist)?
In ihrer Antwort offenbart die Landesregierung, dass es um die Vorbereitung auf einen flächendeckenden Stromausfall schlecht bestellt ist. So verweist sie zum Beispiel auf die Frage nach Notfallplänen und Gegenmaßnahmen für den Fall eines flächendeckenden Stromausfalls auf die Vorlage 17/6531, gibt jedoch keine Notfallpläne an. Aus der Vorlage geht zum Beispiel hervor, dass der digitale Behördenfunk zurzeit nur auf vier Stunden Resilienz gegen Stromausfälle ausgelegt ist, was jedoch im Augenblick auf 72 Stunden erweitert wird. Weiter wird die „Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger“ als ein wichtiger ergänzender Baustein beschrieben. Die Hoffnung auf die Eigenvorsorge der Bürger und das Verlassen auf ein Kommunikationssystem, welches nach vier beziehungsweise 72 Stunden beeinträchtigt ist oder ganz ausfällt, stellt keine ausreichende Vorbereitung dar.
Weiter kann die Landesregierung die Frage nach strafrechtlich relevanten Sachverhalten, welche energieproduzierende oder energieversorgende Infrastruktur beeinträchtigen sollten, nicht beantworten, da „diese Verfahren statistisch nicht gesondert erfasst werden.“ Das Erkennen von Bedrohungen für unsere Stromversorgung und wie diese sich über die Zeit ändern wird damit stark erschwert.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 17/17033).
Altparteien blockierten Opferschutz seit Jahren
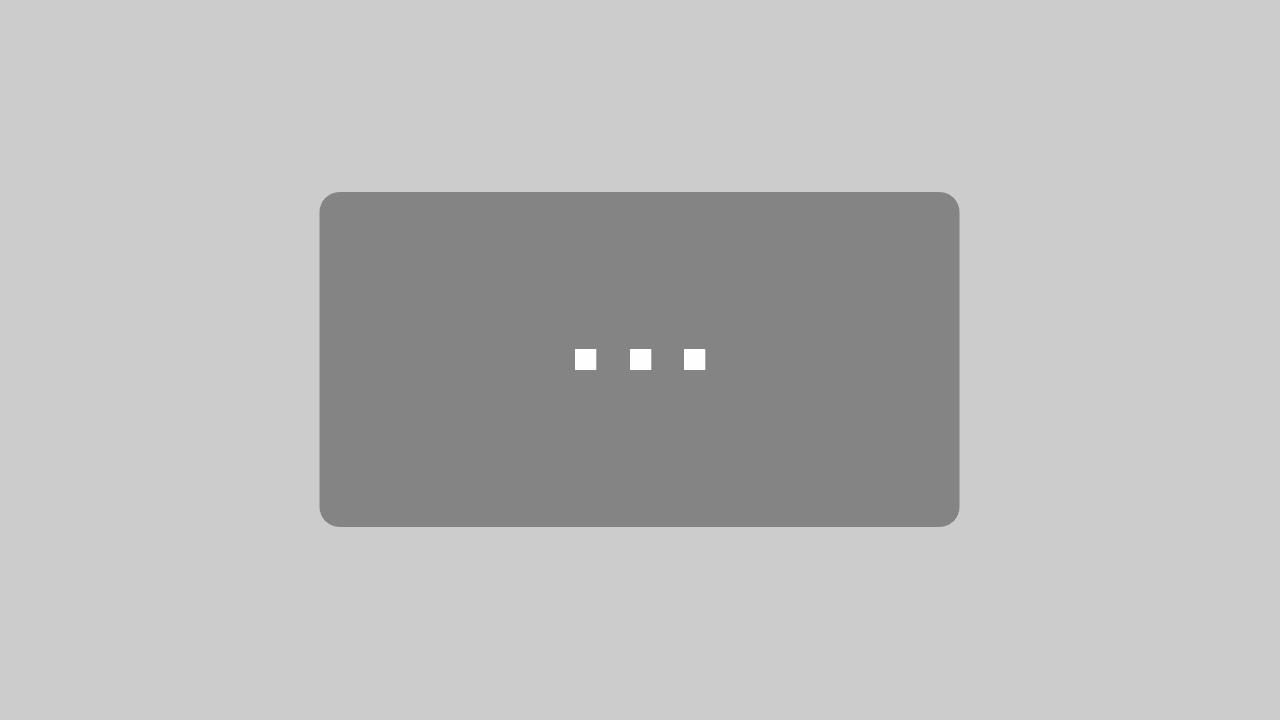
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Der Wahnsinn hat eine Farbe: „Grün“!
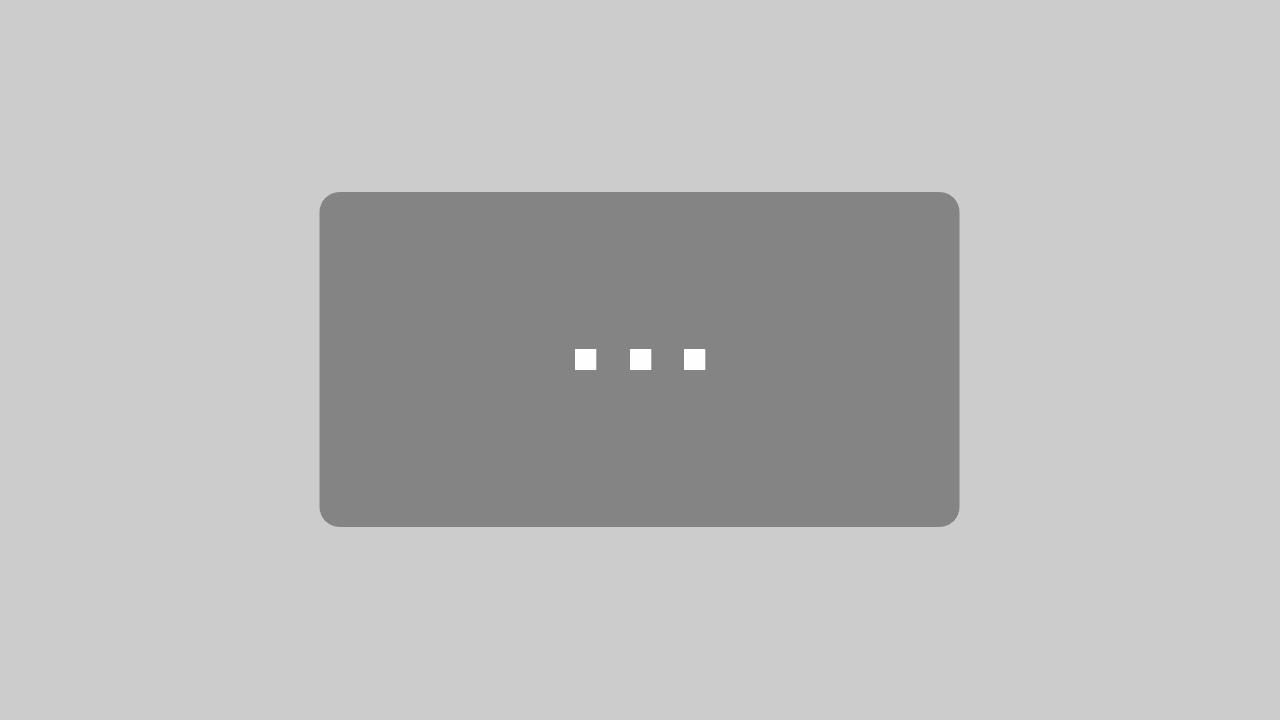
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zum Antrag „Ersatzfreiheitsstrafen vermeiden“ der Grünen (Drucksache 17/16744).
