November 2025
Unsere Gesetze sind für sie eine Einladung zum Töten!
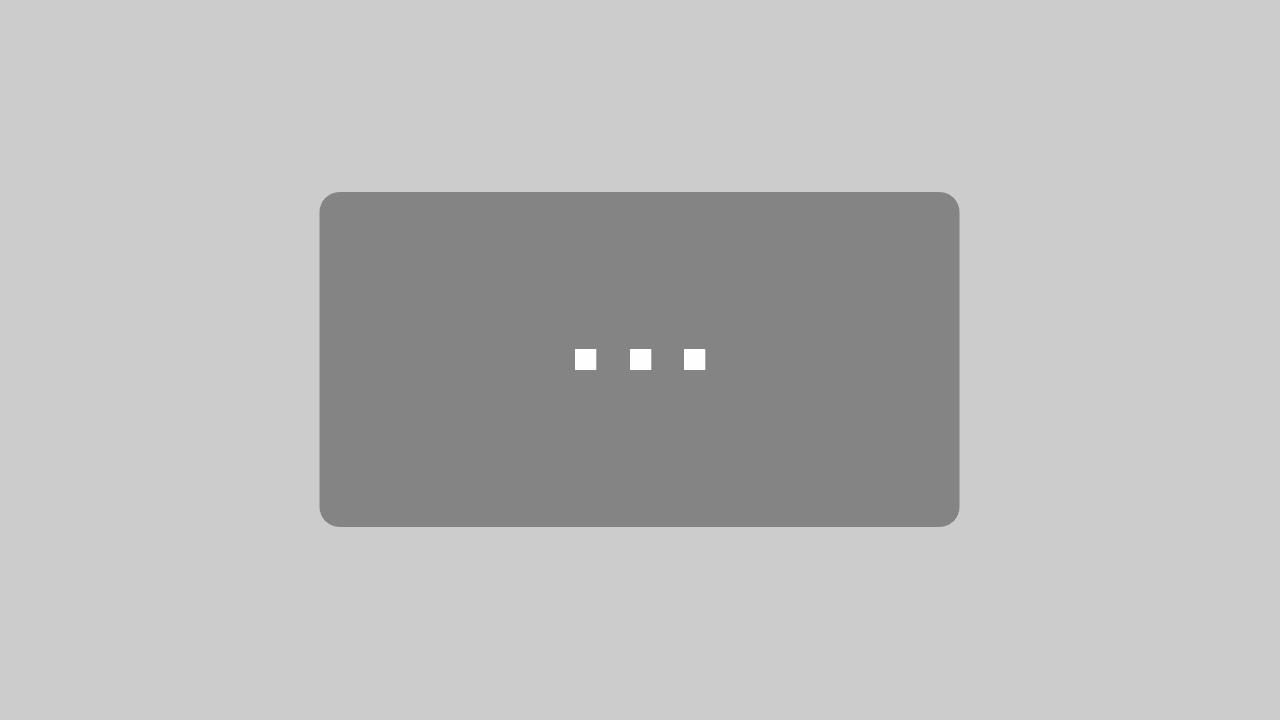
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zur unserer Aktuellen Stunde „Kinder- und Jugendkriminalität in NRW nimmt zu“ (Drucksache 18/16296) in Verbindung mit der Aktuellen Stunde „Jugendkriminalität in Nordrhein-Westfalen – Resignation ist keine Strategie!“ der FDP (Drucksache 18/16295).
Oktober 2025
Schüler sogar zu schlecht fürs Praktikum!
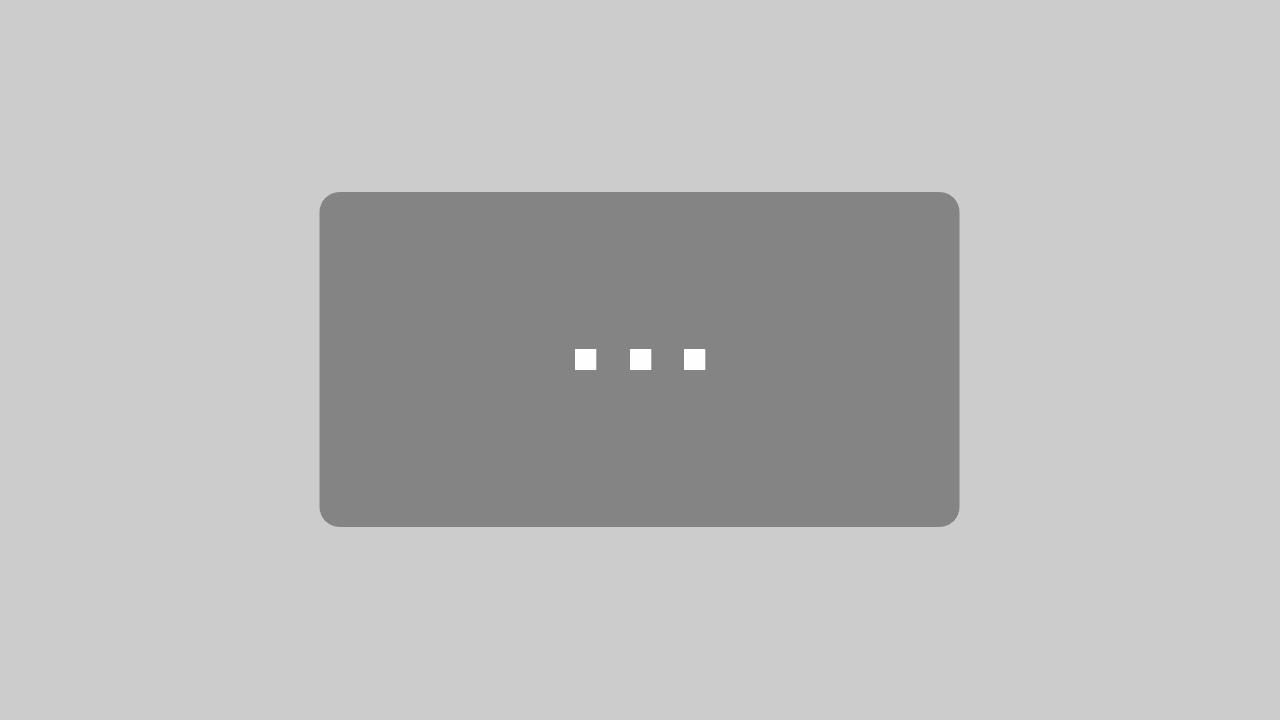
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Pensionseintrittsalter von Beamten im Polizei- und Justizvollzugsdienst sowie von Richtern und Staatsanwälten in NRW
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 6383(Drucksache 18/15575).
Während die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland im Jahr 2024 für Frauen 83,5 Jahre und für Männer 78,9 Jahre betrug, lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 64,7 Jahren.
Für Beamte in Nordrhein-Westfalen richtet sich das Pensionsalter nach den Vorgaben des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen (LBG NRW) sowie den einschlägigen gesetzlichen Sonderregelungen. Dabei bestehen Unterschiede zwischen einzelnen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes. Während für die allgemeine Beamtenschaft stufenweise die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre erfolgt, bestehen für besonders belastende Tätigkeiten, etwa im Polizeivollzugsdienst oder im Justizvollzugsdienst, Sonderregelungen mit abweichenden Altersgrenzen. Auch für Richter und Staatsanwälte gelten eigene Vorschriften.
Neben der allgemeinen Regelaltersgrenze besteht für Beamte unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit, vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Dies ist etwa ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich, wenn die jeweilige Rechtsgrundlage dies vorsieht, und kann auch aus gesundheitlichen Gründen angeordnet werden.
Wir fragten daher die Landesregierung:
- In welchem tatsächlichen Durchschnittsalter sind Beamte des Polizeivollzugsdienstes in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1990 bis 2025 in den Ruhestand getreten? (Bitte nach Jahren und Geschlecht aufschlüsseln)
- In welchem tatsächlichen Durchschnittsalter sind Beamte des Justizvollzugsdienstes in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1990 bis 2025 Ruhestand getreten? (Bitte nach Jahren und Geschlecht aufschlüsseln)
- In welchem tatsächlichen Durchschnittsalter sind Richter in Nordrhein-Westfalen in den 1990 bis 2025 in den Ruhestand getreten? (Bitte nach Jahren und Geschlecht aufschlüsseln)
- In welchem tatsächlichen Durchschnittsalter sind Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen in den 1990 bis 2025 in den Ruhestand getreten? (Bitte nach Jahren und Geschlecht aufschlüsseln)
- Plant die Landesregierung Änderungen bzw. Anpassungen der Altersgrenzen für die zuvor genannten Berufsgruppen, insbesondere im Hinblick auf die Anhebung der Regelaltersgrenze der allgemeinen Beamtenschaft?
Die Antwort der Landesregierung zeigt, dass sich das durchschnittliche Pensionseintrittsalter von Beamten im Polizei- und Justizvollzugsdienst nur knapp ein halbes Jahr unter der Regelaltersgrenze befindet. Bei Richtern und Staatsanwälten ist der Abstand zwischen dem durchschnittlichen Pensionseintrittsalter und der Regelaltersgrenze größer, liegt aber über dem durchschnittlichen Renteneintrittsalter der Gesamtbevölkerung. Auffällig ist, dass bei den beiden letztgenannten Gruppen das durchschnittliche Pensionseintrittsalter der Frauen in den letzten Jahren zirka ein Jahr unter dem der Männer lag.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/16102).
Antifa-Sumpf austrocknen!
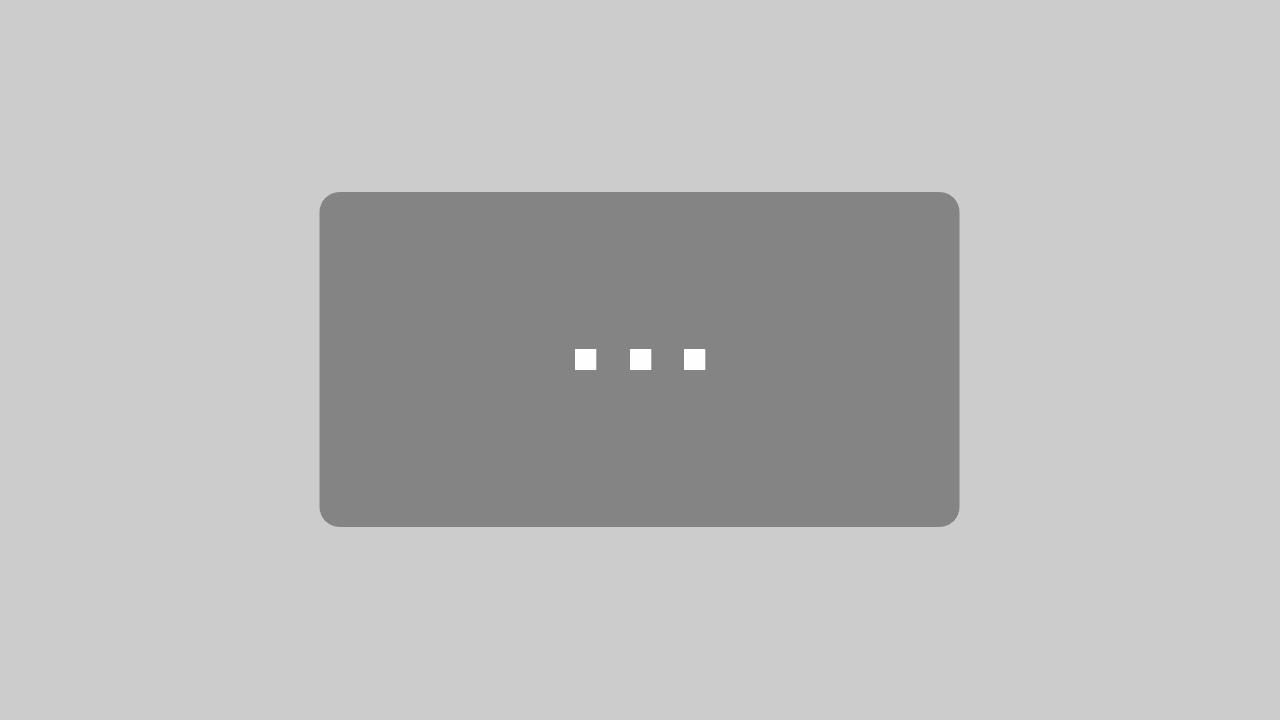
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Welche Auswirkungen hat die Teil-Legalisierung von Cannabis auf laufende und bereits abgeschlossene Strafverfahren in Nordrhein-Westfalen?
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 6288 (Drucksache 18/15371).
Mit Wirkung zum 1. April 2024 ist das „Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften“ (Cannabisgesetz – CanG) in Kraft getreten. Neben der teilweisen Legalisierung des Besitzes, Anbaus und Konsums von Cannabis sieht das Gesetz insbesondere im Rahmen des Art. 13 CanG eine rückwirkende Amnestie für bestimmte, zuvor strafbare Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) vor.
Infolge der Gesetzesänderung sind auch in Nordrhein-Westfalen umfangreiche Prüfungen sogenannter Altfälle erforderlich geworden. Laut Angaben des Justizministeriums NRW waren hiervon Ende April 2024 mehr als 86.000 Verfahren betroffen, darunter etwa 9.000 mit bereits rechtskräftigem Urteil. Zahlreiche Inhaftierte wurden infolge der Neuregelungen frühzeitig aus dem Justizvollzug entlassen.
Dabei erfolgen die Überprüfungen bislang ausschließlich durch manuelle Einzelfallbearbeitung. Dies führt zu einer erheblichen Mehrbelastung der Justiz, da neben bereits vollstreckten Entscheidungen auch anhängige Ermittlungs- und Strafverfahren sowie Gesamtstrafen mit cannabisbezogenen Tatbeständen erfasst und gegebenenfalls einer Neubewertung oder Anpassung unterzogen werden müssen.
Wir fragten daher die Landesregierung:
- Wie viele strafrechtliche Ermittlungs- und Strafverfahren wurden in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2024 wegen Verstößen gegen Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes im Zusammenhang mit Cannabis eingeleitet bzw. abgeschlossen? (Bitte nach Monat, Jahr, Deliktart und Verfahrensstadium aufschlüsseln)
- Wie viele neue Ermittlungs- und Strafverfahren wurden seit dem 1. April 2024 in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Cannabisdelikten eingeleitet, insbesondere wegen Verstößen gegen die Besitz- oder Anbaugrenzen gemäß dem Cannabisgesetz? (Bitte nach Monat, Jahr, Deliktart und Verfahrensstadium aufschlüsseln)
- Wie wurde mit sogenannten Altfällen im Zusammenhang mit Cannabisdelikten seit dem 1. April 2024 in Nordrhein-Westfalen umgegangen? (Bitte die Verfahren differenziert nach folgenden Ergebnissen aufschlüsseln: überprüft, eingestellt, teilweise abgeändert oder vollständig aufgehoben)
- Wie wurde mit rechtskräftigen Urteilen wegen Cannabisdelikten seit dem 1. April 2024 in Nordrhein-Westfalen verfahren? (Bitte die Anzahl der Fälle detailliert nach Überprüfung, nachträglich ganz oder teilweise aufgehoben, korrigiert oder im Rahmen einer neuen Gesamtstrafenbildung angepasst aufführen)
- In wie vielen Fällen kam es infolge des Inkrafttretens des CanG zu einer vorzeitigen Entlassung aus dem Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen?
Die Antwort der Landesregierung zeigt, dass es im ersten Quartal 2024, das heißt kurz vor dem Inkrafttreten des CanG, zu einem starken Anstieg der Ermittlungs- und Strafverfahren im Zusammenhang mit Cannabis kam: Rechnet man die Zahl der Ermittlungs- und Strafverfahren auf das Jahr hoch, kann man einen Anstieg von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erkennen.
In den letzten drei Quartalen 2024 soll es laut der Landesregierung zu 3420 Straftaten nach dem Konsumcannabisgesetz und Medizinal-Cannabisgesetz gekommen sein. Hochgerechnet auf ein ganzes Jahr ergibt sich damit eine Verringerung der Straftaten auf ein Zehntel im Vergleich zu den Vorjahren unter dem Betäubungsmittelgesetz.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/16046).
FDP verfasst ihr politisches Testament!
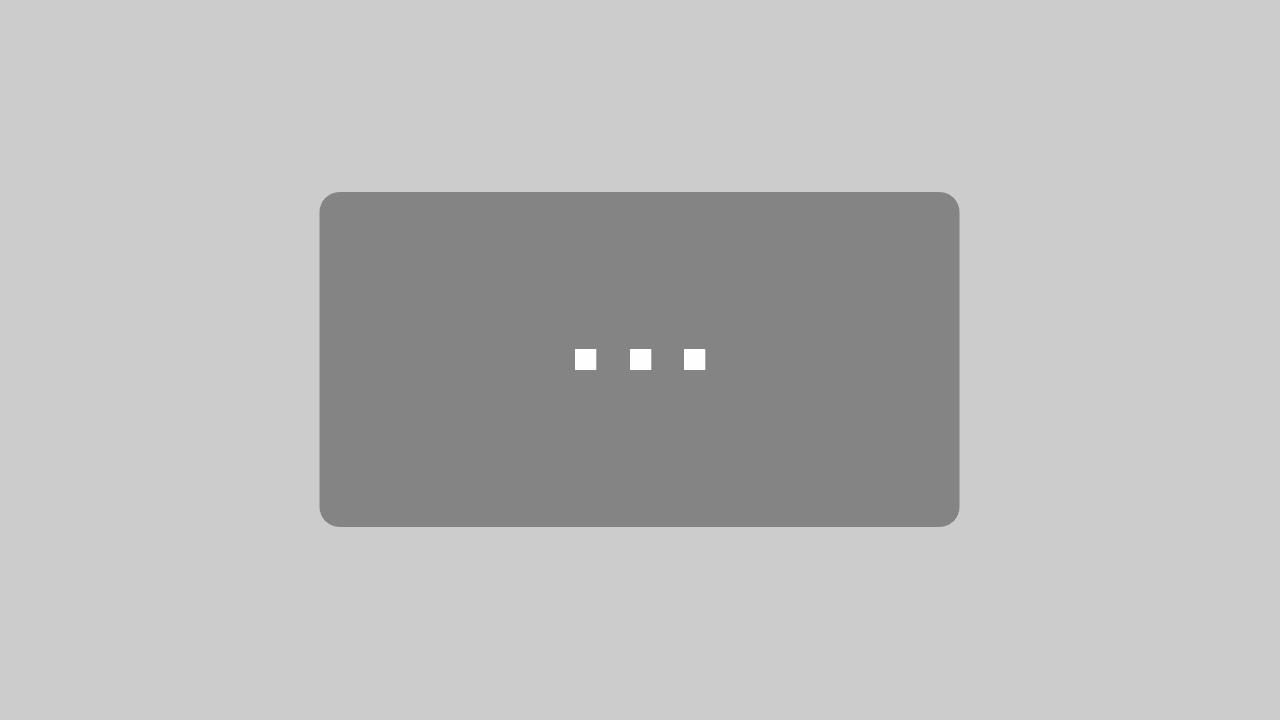
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
September 2025
Nachfrage zur Kleinen Anfrage 5825 – Krankenhausskandal im Kreis Minden-Lübbecke – Welche Rolle spielt Minister Laumann?
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 6233 (Drucksache 18/15278).
Mit Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 5825 “Krankenhausskandal im Kreis Minden-Lübbecke – Welche Rolle spielt Minister Laumann?” (Drucksache 18/14909) wurde Frage 4 wie folgt beantwortet:
„Frau Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Detmold Anna Katharina Bölling stellte das Vorhaben der Mühlenkreiskliniken am 26. April 2022 in ihrer ehemaligen Funktion als Landrätin den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MAGS vor.
Um den Krankenhausträger bei der Finalisierung seiner Antragsunterlagen zu unterstützen, wurden dann fortlaufend Gespräche zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MAGS, dem Krankenhausträger und zum Teil unter Beteiligung von Frau Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Detmold Anna Katharina Bölling bzw. später ihrem Nachfolger in der Funktion des Landrates des Kreises Minden-Lübbecke Herrn Landrat Ali Dogan geführt. An wenigen Gesprächen war auch ich beteiligt. Wesentliches Ziel dabei war die Sicherstellung einer fristgerechten Antragsstellung beim Bundesamt für Soziale Sicherung.“
Darüber hinaus wurde Frage 5 wie folgt beantwortet:
„Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz vom 5. Dezember 2024 wurde für die Jahre 2026 bis 2035 ein Transformationsfonds eingerichtet. Mit diesem sollen Vorhaben gefördert werden, mit denen die Krankenhausstrukturen in Deutschland im Sinne der Krankenhausreform angepasst werden.
Die Mühlenkreiskliniken könnten grundsätzlich im Rahmen eines Antragsverfahrens einen Antrag auf Förderung stellen.“
Wir wünschten in Hinblick auf diese Antworten detailliertere Informationen und fragten daher die Landesregierung:
- Wann haben der Ministerpräsident, ein oder mehrere Minister und/oder Mitarbeiter eines Ministeriums mit der Landrätin bzw. dem Landrat, Mitarbeitern des Kreises Minden-Lübbecke, leitenden Mitarbeitern der Mühlenkreiskliniken, Mitgliedern der Bezirksregierung und/oder Verwaltungsmitarbeitern bezüglich des in Frage stehenden Förderantrags in welcher Konstellation wie miteinander kommuniziert? (Bitte nach Teilnehmern, Kommunikationsmitteln, Dauer und Inhalten aufschlüsseln)
- Wurden im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Juli 2025 in vergleichbaren Verfahren entsprechend bereits gestellte Anträge bewilligt? (Bitte nach entsprechenden Sachverhalten unter Benennung der angewandten Rechtsvorschriften bzw. Vertrauenstatbeständen aufschlüsseln)
Leider scheint die Landesregierung in ihrer Antwort nicht bereit, weitere Details zu nennen. Sie teilt nur mit, dass schon seit Mai 2020 bezüglich des Förderantrags eine Kommunikation bestand – nicht, wie in der Antwort auf die vierte Frage der Kleinen Anfrage 5825 behauptet, erst seit April 2022. Bezüglich der Teilnehmer, Dauer und Inhalten der Kommunikationen schweigt die Landesregierung.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/15829).
Steigende Asylgerichtsverfahren in Nordrhein-Westfalen – Entwicklung der staatlichen Prozesskostenhilfe
Zur vollständigen Kleinen Anfrage 6228 (Drucksache 18/15273).
Die Zahl der asylrechtlichen Verfahren gegen ablehnende Bescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Allein im Jahr 2024 gingen bei den nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichten rund 19 300 neue Asylverfahren ein – mehr als in jedem anderen Bundesland. Dabei haben sich die Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, während bundesweit ein Anstieg von über 67 Prozent zu verzeichnen ist.
Diese Entwicklung stellt die Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen vor erhebliche Herausforderungen. Asylverfahren sind regelmäßig komplex, sprachlich anspruchsvoll und mit einem erhöhten Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand verbunden. Neben der organisatorischen Belastung wirkt sich das stark gestiegene Verfahrensaufkommen zunehmend auch finanziell aus. So nimmt mit dem Anstieg der Fallzahlen die Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe spürbar zu. In zahlreichen Fällen werden asylrechtliche Verfahren vollständig aus öffentlichen Mitteln finanziert, die in der Konsequenz vom Steuerzahler zu tragen sind.
Wir fragten daher die Landesregierung:
- Wie viele Verfahrenseingänge bzw. -erledigungen asylrechtlicher Verfahren gab es vom ersten Quartal 2022 bis zum zweiten Quartal 2025 an den nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichten? (Bitte differenziert nach Jahr/Quartal, Gericht sowie Haupt- und Eilverfahren angeben)
- In wie vielen der oben genannten Fälle war bzw. ist den Klägern Prozesskostenhilfe bewilligt worden? (Bitte differenziert nach Jahr/Quartal, Gericht sowie Haupt- und Eilverfahren angeben)
- In welcher Höhe sind in asylrechtlichen Verfahren vor den nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichten vom ersten Quartal 2022 bis zum zweiten Quartal 2025 insgesamt Prozesskostenhilfe bewilligt worden?
- Wie hat sich die durchschnittliche Dauer der erledigten asylrechtlichen Verfahren vor den nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichten seit dem Jahr 2022 entwickelt? (Bitte differenziert nach Jahr und Gericht angeben)
- Wie bewertet die Landesregierung langfristig das Verhältnis zwischen der Anzahl der Asylverfahren und den verwaltungsgerichtlichen Kapazitäten in Nordrhein-Westfalen?
Die Antwort der Landesregierung zeigt deutlich, dass die Zahl der Asylgerichtsverfahren steigt: So steigerte sich zum Beispiel die Zahl der neuzugegangenen Hauptverfahren vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf zwischen 2022 und 2024 um mehr als 50 Prozent. Dieser Trend scheint sich auch weiterhin fortzusetzen, da in den ersten zwei Quartalen 2025 die Zahl der Neuzugänge mehr als 40 Prozent höher lag als in den Vorjahresquartalen. Die Zahl der erledigten Verfahren stieg hingegen nur um zirka 26 Prozent beziehungsweise 29 Prozent. Es scheint also, dass, auch wenn das Verwaltungsgericht Düsseldorf zu den effizienteren Gerichten zu gehören scheint, auch dieses mit der Flut der Verfahren überfordert ist.
Zur vollständigen Antwort der Landesregierung (Drucksache 18/15856).
